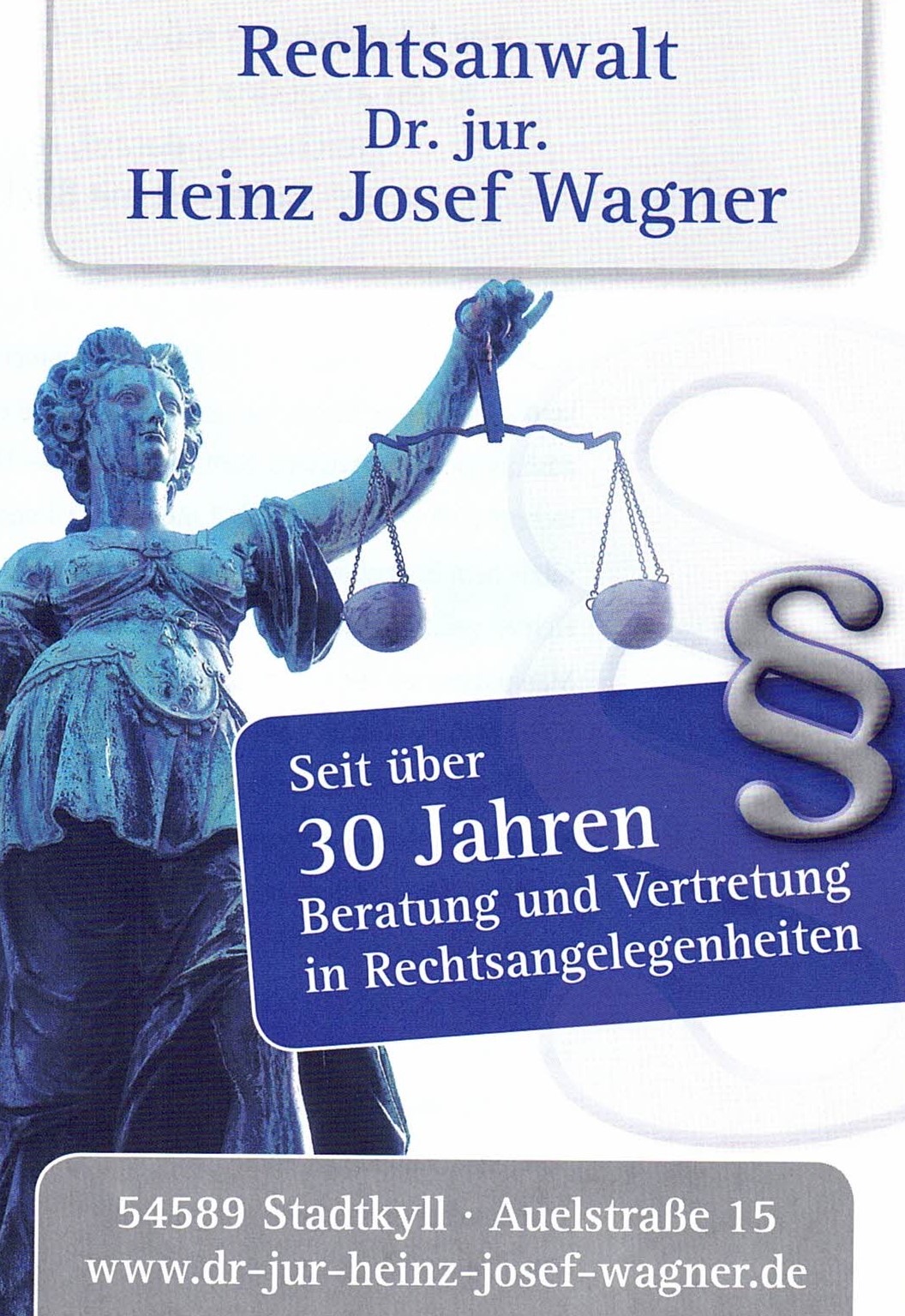Beschluss des Landgerichts Trier vom 28.01.2010, Az. 5 O 11/10 und
Beschluss des Oberlandesgerichts Koblenz vom 22.04.2010, Az. 6 W 118/10 - §§ 311 b Abs. 1, 812 Abs.1 Satz 2, 2. Alt., 823 Abs. 2, 249 Abs. 1 BGB, culpa in contrahendo
Ansprüche gegen den Alleinerben aufgrund im Vertrauen auf eine spätere Erbeinsetzung erbrachter Aufwendungen für den Erblasser
Der Antragsteller begehrte vor dem LG Trier und im anschließenden Beschwerdeverfahren vor dem OLG Koblenz erfolglos Prozesskostenhilfe für eine Klage.
Der Antragsteller beabsichtigte, den Antragsgegner als Alleinerben in Anspruch zu nehmen. Der Erblasser war Eigentümer eines Hausgrundstücks gewesen. Der Antragsteller machte vor dem Landgericht geltend, einen Anspruch auf Auflassung und Übertragung des Eigentums an dem Hausgrundstück zu haben. Hilfsweise machte der Antragsteller geltend, einen Anspruch auf eine Entschädigung in Höhe von 25.000,00 € zu haben. Und zwar für die in der Erwartung, er werde das Hausgrundstück erben, in 6 Jahren für den Erblasser aufgewendete Arbeitszeit.
Mit Beschluss vom 28.01.2010 wies das LG Trier den Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ab. Das LG Trier führte hierzu aus: Mit dem Hauptantrag auf Übereignung des Hausgrundstücks könne der Antragsteller keinen Erfolg haben. Die Verpflichtung, ein Grundstück zu übereignen, bedürfe der notariellen Beurkundung, § 311 b Abs. 1 BGB. Auf die Verletzung einer formnichtigen Vereinbarung könne ein Schadensersatzanspruch, der auf Erfüllung gerichtet sei, nicht gestützt werden.
Auch der Hilfsantrag auf Zahlung von 25.000,00 € habe keine hinreichenden Erfolgsaussichten. In erster Linie wäre an einen Bereicherungsanspruch wegen Zweckverfehlung gemäß § 812 Abs. 1 Satz 2, 2. Alt. BGB zu denken. In Betracht käme nach dem Vorbringen des Antragstellers auch ein Schadensersatzanspruch nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 263 StGB. Schuldner derartiger Ansprüche wäre der Erbe.
Es gäbe, so das LG weiter, jedoch erhebliche Indizien, die dagegen sprächen, dass der Antragsteller im Vertrauen darauf, durch Übereigung des Hausgrundstücks entschädigt zu werden, Arbeitsleistungen für den Erblasser erbracht habe. Der Notar habe zwar einen Erbvertrag entworfen, in dem insbesondere die von dem Antragsteller zu erbringenden Pflege- und Versorgungsleistungen präzisiert worden seien. Dieser Vertrag sei jedoch nicht geschlossen worden.
Der Antragsteller habe demnach gewusst, dass der Erblasser eine Verpflichtung, ihn an dem Nachlass zu beteiligen, gerade nicht übernommen habe. Umgekehrt habe der Antragsteller dem Erblasser die in dem Erbvertragsentwurf in Aussicht genommenen Leistungen gerade nicht geschuldet. Daran ändere auch das zwischenzeitlich zu Gunsten des Antragstellers errichtete Testament nichts. Es habe - im Gegensatz zu einem Erbvertrag - eben keine gegenseitigen Rechte und Pflichten begründet.
Die bloße ungesicherte Hoffnung des Antragstellers, dass er an dem Nachlass beteiligt würde, werde nicht durch das Gesetz geschützt. Der Antragsteller und der Erblasser hätten sich dazu entschlossen, von der Vereinbarung eines Erbvertrages abzusehen. Diese Entscheidung könne nicht nachträglich durch einen bereicherungsrechtlichen Ausgleich abgeändert werden.
Mit Beschluss vom 22.04.2010 wies das OLG Koblenz die sofortige Beschwerde des Antragstellers gegen den die Gewährung von Prozesskostenhilfe ablehnenden Beschluss des LG Trier zurück.
Das OLG führte ergänzend aus, dass der Abbruch von Vertragsverhandlungen regelmäßig sanktionslos sei. Die Parteien seien bis zum endgültigen Vertragsschluss in ihren Entschließungen grundsätzlich frei, und zwar auch dann, wenn der andere Teil in Erwartung des Vertrages Aufwendungen gemacht habe. Eine Ersatzpflicht bestehe nur dann, wenn eine Partei die Verhandlungen ohne triftigen Grund abbreche, nachdem sie in zurechenbarer Weise Vertrauen auf das Zustandekommen des Vertrages erweckt habe. Von diesen Grundsätzen sei auch bei der Beantwortung der Frage auszugehen, ob ein Verhandlungspartner bei Abbruch der Verhandlungen unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens bei Vertragsschluss (culpa in contrahendo) verpflichtet sei, Aufwendungen des anderen zu ersetzen. Dies gelte grundsätzlich auch im Hinblick auf die Formbedürftigkeit des abzuschließenden Vertrages.
Allerdings sei hier zu fordern, dass das Verhalten des in Anspruch Genommenen sich als besonders schwerwiegender Treueverstoß darstelle. In der Regel komme daher nur eine vorsätzliche Treuepflichtverletzung als Grundlage eines Schadensersatzanspruchs aus culpa in contrahendo in Betracht, wie sie im Vorspiegeln tatsächlich nicht vorhandener Abschlussbereitschaft liege. Dem sei nach Treu und Glauben der Fall gleichzustellen, dass ein Verhandlungspartner zwar zunächst eine solche, von ihm geäußerte, Verkaufsbereitschaft tatsächlich gehabt habe, im Verlauf der Verhandlungen aber innerlich von ihr abgerückt sei, ohne dies zu offenbaren. Ein solcher Sachverhalt ließe sich vorliegend aber nicht feststellen.
Ebensowenig bestehe ein Schadensersatzanspruch auf Entlohnung für die in 6 Jahren aufgewendete Arbeitszeit. Auch könne der Antragsteller weder die Eigentumsübertragung am Grundstück oder Zahlung des Grundstückswertes noch die Entlohnung seiner Arbeitsleistungen aus dem Gesichtspunkt einer ungerechtfertigten Bereicherung verlangen.
Dem Antragsteller blieb die beantragte Prozesskostenhilfe daher insgesamt versagt.
(zurück)